Von wegen Gängelung
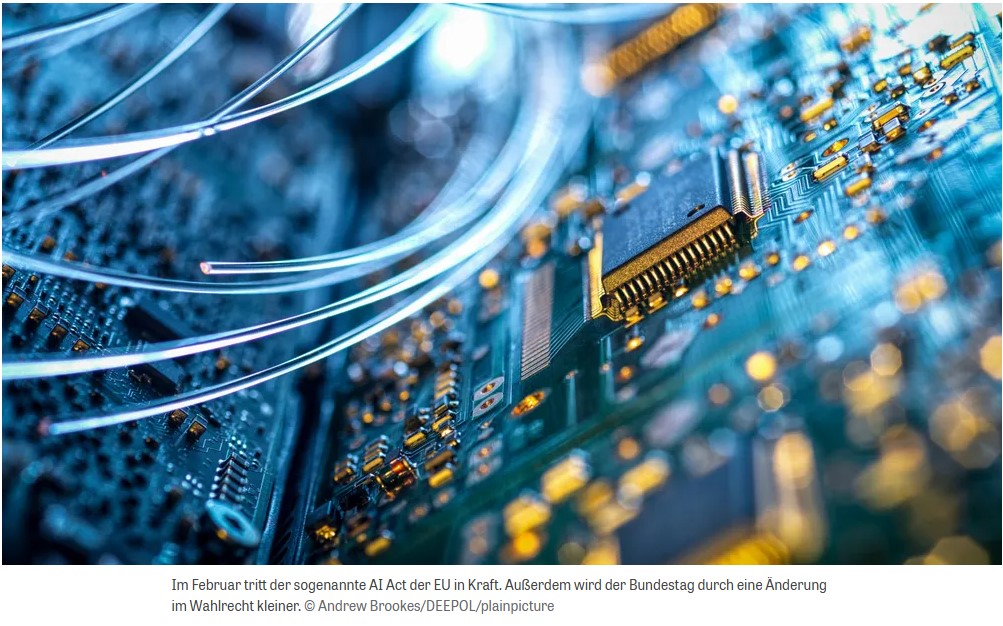
Die EU beschließt das erste Gesetz für künstliche Intelligenz. Hilft das gegen die Macht der Konzerne?
Was die Zukunft wohl bringen wird? Die Wortführer der Techindustrie haben da recht konkrete Vorstellungen: Mit künstlicher Intelligenz (KI, englisch: AI), sagen sie, ließen sich Menschen bald virtuell klonen (Mark Zuckerberg, Chef von Meta). Die Technologie werde mehr verändern als die Entdeckung von Feuer und Elektrizität (Sundar Pichai, Google) und klüger sein als der Mensch (Elon Musk, X, Tesla) – schon Ende 2025! Aber keine Sorge: Sam Altman, der Mann hinter ChatGPT, denkt bereits über ein bedingungsloses Grundeinkommen nach. Für den Tag, an dem die Maschinen unsere Arbeit übernehmen. Diese Männer stellen keine Fragen. Sie informieren uns nur. Da schwingt ordentlich Größenwahn mit.
Der AI Act der Europäischen Union, der nun ab August in Kraft tritt, das erste KI-Gesetz der Welt, ist deshalb eine überfällige Erinnerung: Unternehmer sind dem Schutz der Daten und Grundrechte ihrer Kunden verpflichtet. Auch wenn sie sich zu Höherem berufen fühlen: zur Neuerfindung der Welt.
Bremsen die neuen Vorschriften Innovation in Europa?
Das Gesetz soll Bürger vor besonders Missbrauchs-anfälliger KI schützen. Gegner des Vorhabens sehen darin einen neuen Beweis für die Brüsseler Regulierungswut, die Neigung, eher Gefahren zu erkennen als Chancen. Aber so ist es nicht.
Der AI Act regelt vier Kategorien. Da sind erstens Anwendungen, die grundsätzlich verboten werden. Soziale Kreditsysteme nach chinesischem Vorbild zum Beispiel, mit denen Staaten ihre Bürger benoten und gängeln. Zweitens: Hochrisikoanwendungen, die etwa über Asylanträge entscheiden oder Bewerbungen auf Stellenanzeigen sortieren – und deshalb besonders strengen Kontrollen unterliegen. Platz drei in der Regulierungspyramide: Programme mit begrenztem Risiko, zum Beispiel Bots wie ChatGPT. Deren Anbieter müssen künftig unter anderem offenlegen, mit wessen Daten sie ihre KI trainiert haben. Unreguliert bleiben Dienste wie Spamfilter für E-Mails.
Das ist nicht übereifrig, sondern erstaunlich differenziert. Zumal die EU keine irrwitzigen Science-Fiction-Modelle reguliert, sondern realistische Szenarien. Beispiel „Emotionserkennung am Arbeitsplatz“. Klingt abwegig? Nicht für Kassiererinnen in Japan: Dort lässt eine Supermarktkette das Lächeln ihrer Mitarbeiter beobachten und auswerten, als Maßstab für deren Kundenfreundlichkeit. Bei Edeka wäre das nun verboten.
Wenn bald also endlich etwas Licht in die Blackboxes der KI-Systeme fällt, wenn Inhalte, die eine KI erschaffen hat, als solche erkennbar sind und Verbraucher nachvollziehen können, ob am anderen Ende der Kundenhotline ein Mensch oder eine Maschine mit ihnen spricht, dann dürften davon langfristig auch die Anbieter profitieren. Es vertraut sich leichter in Technologien, auf die man nicht ständig hereinfällt.
Und das Vertrauen schwindet gerade. Künstliche Intelligenz, das ist oft noch so ähnlich wie der Praktikant, der so unzuverlässig arbeitet, dass man die wichtigen Aufgaben lieber schnell selbst erledigt. Deshalb werden reale Erfolgsmeldungen eher ignoriert: dass KI tatsächlich vorhersehen kann, wie Proteine sich falten, was Alzheimerpatienten Hoffnung auf bessere Therapien gibt. Oder die internationale Mathematik-Olympiade, bei der eine Künstliche Intelligenz von Google kürzlich zum ersten Mal eine Silbermedaille gewann.
Richtet die EU mit ihrem Gesetz also mehr Schaden an, als sie verhindert? Weil sie reguliert, was andere erfinden, und damit Innovation in Europa erschwert? Kurze Antwort: Nein. Man kann sich für die Technologie begeistern und trotzdem finden, dass zu viel Macht in den Händen einiger weniger liegt. Aber die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los.
In zwei Jahren wird der AI Act vollständig anwendbar sein. Zwei Jahre bleiben den Unternehmen, um sich darauf vorzubereiten. Das dürfte für die kleinen, tendenziell europäischen Anbieter schwieriger werden als für global operierende Konzerne mit großen Rechtsabteilungen. Umso wichtiger, es ihnen nicht unnötig schwer zu machen: durch klare Zuständigkeiten statt Behörden-Pingpong. Das ist Aufgabe der Mitgliedsstaaten.
In Deutschland muss erst noch eine Aufsichtsbehörde ausgewählt werden. Der Singular ist wichtig. Es würde nämlich sehr helfen, wenn es nur eine wird – nicht gleich sechzehn.
Quelle: Die Zeit




